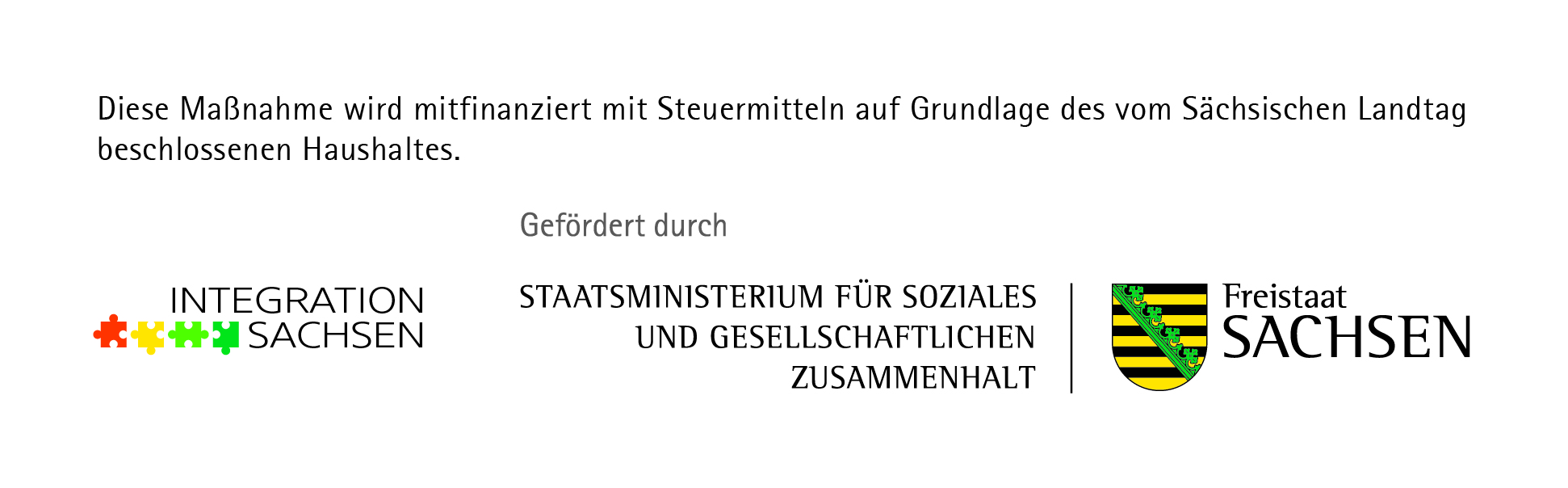At Treffpunkt ostZONE. Remembering and Shaping, every biography was valued – across generations and interculturally. Some participants wrote down their stories and memories about life in the GDR or expanded their personal collections, which had been created well before the project. The focus was on short stories about life and everyday life in the GDR.
Wolfgang gave us her notes and agreed to publish them.
Stories and memories of Wolfgang
Kleine Nachtmusik oder Großvaters Geigenspiel | Opel Blitz 3t. | Begegnung der Brückenbauer oder die verpasste Chance
Von „Street fighting man“ bis „Langeweile“. Spätpubertäre Wunschträume | Gestrandet – Eine Jugendsünde
Aufgemuckt | „Je t`aime“ eingehakt | Der Steuermann | Westbesuche | Volle Drehung | Toccata und Fuge d-Moll
Augen auf und durch | Überfahren | Mutter und Vietnam | Eine Frage an den Genossen Wolf
Das Jahr 1989 – ein persönlicher Bericht | Wie ich den 4. November 1989 erlebte
5 DM für einen Stadtplan | Wie das Jahr 1989 für mich endete und das Jahr 1990 für mich begann
Meuterei? Beelitz „Friedrich-Wolf-Kaserne“ 2. Januar 1990 | Wanzen können nützlich sein
Kleine Nachtmusik oder Großvaters Geigenspiel
Ob die folgende Begebenheit meiner Erinnerung oder der meiner Eltern entspringt, kann ich nicht eindeutig beantworten. Jedenfalls ist sie wahr. Ich muss nicht älter als drei Jahre gewesen sein und war mit den Eltern und meiner jüngeren Schwester zu Besuch bei den Großeltern. Die wohnten zu der Zeit in einem kleinen havelländischen Dorf. Ihr Haus hatte einen kleinen Hof, auf dem wir Kinder gerne spielten. Eines Abends kam Opa Scheder auf die Idee, uns etwas auf seiner Geige vorzuspielen, damit meine Schwester und ich schneller einschlafen. Als wir im Bett lagen, holte er seine Geige und begann leise zu spielen. Statt einer Gute-Nacht-Geschichte kam nun eine kleine Nachtmusik. Sein Spiel, aber vor allem die Geige beeindruckten mich so sehr, dass ich trotz geschlossener Augen nicht müde wurde. Immer, wenn er zu spielen aufhörte, weil er glaubte, wir schliefen, war ich wieder voll da und sagte „weiter“ oder „noch mal“ zu ihm. Anfangs fand er das noch amüsant, aber nach mehreren „Wunsch-Zugaben“ für mich gab er schließlich etwas genervt auf.
In dem Moment, in dem er seine Geige wieder einpackte, schlief ich beruhigt ein.
Opel Blitz 3t.
Dieser LKW gehört zu den Fahrzeugen, die mich in meiner Schulzeit in Plaue/Havel sehr beeindruckten. Von der Einschulung 1957 bis zur 8. Klasse 1965 gehörte der Sohn eines Kohlenhändlers zu meinen Klassen- und gelegentlich auch Spielkameraden. Wolfgang Reimanns Vater lieferte mit diesem Fahrzeug die Kohlen an die Haushalte im Ort aus, so auch an meine Familie in der damaligen Karl-Marx-Straße 12. Die Kohlenhandlung Reimann befand sich auf dem Hof des Lebensmittelgeschäfts „Ehrenberg“ an der Plauer Hauptstraße. Manchmal hielt auch ich mich dort auf und konnte Wolfgangs Vater bei der Vorbereitung der Kohletransporte oder der Fahrzeugwartung zusehen. Mindestens einmal durfte ich auf der langen Sitzbank im Fahrerhaus Platz nehmen, die mit dunkelgrünem Kunstleder bespannt war, und eine kleine Tour mitfahren.
Begegnung der Brückenbauer oder die verpasste Chance
In meinem Heimatort Plaue/Havel, einem Ort bei Brandenburg an der Havel, gelegen an der Fernverkehrsstraße 1 (F1) von Berlin nach Magdeburg, ereignete sich im Frühjahr 1965 folgende Begebenheit.
Es muss an einem Wochentag gewesen sein, denn ich wollte zur KONSUM-Verkaufsstelle im Ort, die direkt an der F1 lag. Was ich kaufen wollte oder ob es Vor- oder Nachmittag war, weiß ich nicht mehr. Der KONSUM lag auf der gegenüberliegenden Straßenseite, aber ich konnte die Straße wegen des starken Verkehrs nicht überqueren. Aus Richtung Magdeburg kam eine mir endlos scheinende Militärkolonne der NVA (Nationale Volksarmee) und der Verkehr aus der Gegenrichtung war gezwungen, auf der äußerst rechten Seite zu halten. Bei den Militärfahrzeugen handelte sich um große und breite LKW mit Pontons und um Schwimmwagen, also Technik zum Brückenbau. Fast auf Höhe des KONSUMs war auch ein Reisebus der tschechischen Marke SKODA zum Stehen gekommen, der mir wegen seiner Insassen und der Art ihres Gepäcks besonders auffiel. Sie hatten eine sehr dunkle Hautfarbe und führten Behälter für Instrumente mit sich. Einige von ihnen hatten den Bus inzwischen verlassen, um zu rauchen oder sich nur die Füße zu vertreten.
Als angehender 15-Jähriger, dessen Eltern in ihrer Schallplattensammlung auch Jazz-Platten hatten, ahnte ich in diesem Moment schon, um welche Musiker es sich hier handelte. Aus etwa 10 Meter Entfernung konnte ich an einem der Busfenster das runde Gesicht eines offensichtlich kleinen beleibten Mannes gut erkennen. Jetzt war ich mir sicher, dass es sich nur um Louis Armstrong handeln konnte. Mein erster Impuls war, die Straße sprungartig zu überqueren, was möglich gewesen wäre, und an die geöffnete Bustür zu treten, um ihn um ein Autogramm zu bitten. Mein Schul-Englisch hätte dazu gereicht. Mir fehlte aber der Mut und ich zögerte wohl einige Minuten zu lange. Die Bustüren wurden wieder geschlossen und der Reisebus bewegte sich mit der langen Warteschlange langsam vorwärts. Noch am selben Tag oder am nächsten hörte ich im DDR-Rundfunk von der DDR-Tournee der Louis Armstrong-Band. Später wurde im DDR-Fernsehen ein Bericht vom Auftritt Louis Armstrongs in Magdeburg gesendet.
PS: Am 1.Mai 1965 trat Louis Armstrong in der Festhalle Magdeburg auf. Es war eines von 17 umjubelten Konzerten in der DDR.
Zur politischen Lage im Frühjahr 1965: Anfang April (07.04.) tagte der Deutsche Bundestag in West-Berlin. Die Sowjetunion und die DDR sahen darin einen Verstoß gegen den 4-Mächte-Status von Berlin und werteten dies als eine ungeheure Provokation. Der Kalte Krieg war wieder mal auf einem Höhepunkt. Die Sowjetarmee und die NVA begannen mit Truppenübungen, die Teile der Autobahn nach Berlin blockierten und den Straßenverkehr rund um Berlin erheblich behinderten.
Als die wahren Brückenbauer zwischen Ost und West erwiesen sich in dieser Zeit die Musiker um Louis Armstrong.
Von „Street fighting man“ bis „Langeweile“. Spätpubertäre Wunschträume
Das Schuljahr 1965/-66 begann für mich an der Erweiterten Oberschule „Johann Wolfgang Goethe“ in Brandenburg an der Havel. Heute bezeichnet man eine solche Schule als Gymnasium. Neben der schulischen Ausbildung gab es noch eine Berufsausbildung. Ich hatte mich für die Ausbildung zum Stahlwerker entschieden, weil mein Großonkel Walter Rudel im Stahl- und Walzwerk Brandenburg Lehrobermeister war. Da ich im Ortsteil Plaue wohnte, musste ich täglich mit der Straßenbahn zur 15 km entfernten Schule oder Berufsschule fahren. Als sogenannter Fahrschüler blieb mir aber noch genügend Zeit, meinen Interessen nachzugehen. Außerdem gab es ja noch die Schulferien. Gern durchstreifte ich mit dem Fahrrad die Umgebung meines Heimatortes. Die Kleinbildkamera „Werra“ meines Großvaters hatte ich manchmal dabei. Abends las ich gern Zukunftsromane (heute heißen sie Science-Fiction-Romane) oder Fachliteratur über Jagdwesen, Kfz-Technik oder Fotografie. Oft hörte ich dazu Radiomusik. Zunächst mit einem Detektor, den ich unter Anleitung meines Vaters gebaut hatte. Ein Detektor ist ein Radio im Miniformat, bei dem man Kopfhörer braucht, um etwas hören zu können. Mit diesem Detektor konnte ich zwei Sender gut empfangen, den „Deutschen Soldatensender“ und den „Freiheitssender“. Das waren Sender, die sich mit ihrem Programm ausschließlich an die westdeutschen Hörer wandten, obwohl sie auf dem Gebiet der DDR standen. Ihre Musik war westliche Beat- und Schlagermusik. Diese Musik zog mich immer mehr in ihren Bann. Als sich meine Großeltern ein neues Rundfunkgerät anschafften, stellten sie ihr altes Gerät ins Kinderzimmer. Mit diesem großen Kasten konnte ich nun mehr Sender empfangen. Mein beliebtester Sender wurde der „Sender Freies Berlin“, der in West-Berlin stand. Für mich war er ein antikapitalistischer Sender, denn er berichtete auch positiv über die Studentenproteste und die Anti-Kriegs-Bewegung in Westberlin und Westdeutschland. Solche Titel von den Rolling Stones wie „Street fighting man“ oder „Revolution“ von den Beatles bewegten mich sehr. Aber auch romantische Songs wie „Atlantis“ von Donavan oder „Pictures Of Matchstick Men“ von Status Quo beflügelten meine Fantasie, denn eigentlich war ich ein Träumer.
Ich träumte vom Sieg des Sozialismus über den Kapitalismus, wobei das Beste aus beiden Systemen, aus Ost und West verschmelzen sollte. Vom Westen sollte das unter anderem die Jazz- und Beatmusik sein. Auch gegenüber Mädchen war ich eher ein Träumer, das heißt, mein Verhältnis zu Frauen und Mädchen war ein platonisches. Ich schwärmte von dieser oder jener, aber es blieb bei rein geistiger, also platonischer Liebe. Kurt Tucholsky beschrieb die platonische Liebe treffend, indem er feststellte: „Platonische Liebe ist wie ewig zielen aber niemals abdrücken“.
Anders verhielt es sich mit meinem Verhältnis zum Staat DDR und seiner Politik. Keine Zurückhaltung zeigte ich, wenn es galt, Funktionen und Aufgaben in der Pionierorganisation oder der FDJ (Freie Deutsche Jugend) zu übernehmen. Außerdem wollte ich in die SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) eintreten. Meine Eltern waren in dieser Partei und sie waren meine Vorbilder. So einfach, wie ich mir das vorstellte, war der Eintritt in die SED aber nicht. Als Lehrer gehörten meine Eltern der Intelligenz an, und die war in der führenden Arbeiter- und Bauernpartei gerade nicht gefragt. Mir wurde erklärt, dass erst wieder mehr Arbeiter und Bauern in die Partei eintreten müssen, bevor ich einen Aufnahmeantrag stellen durfte. Das sah ich zwar ein, war aber trotzdem verärgert. Aus Protest wollte ich sogar in eine Blockpartei eintreten. Am besten in die CDU (Christlich Demokratische Union), denn die wollte auch das Gleiche wie die SED, nur dass sie eben den Kirchen nahestanden. Dann wurde die Partei auch noch als „Club der Ungeküssten“ verspottet. Mein Protest blieb deshalb nur ein stiller. Das blieb so bis in die 1980er Jahre, obwohl bei mir zunehmend Zweifel an dieser oder jener Maßnahme der Partei- und Staatsführung aufkamen. Spätestens seit Glasnost und Perestroika in der Sowjetunion erhoffte ich mir einen offeneren Umgang mit den gesellschaftlichen Problemen. Ich begehrte aber nicht offen auf, äußerte meine Kritik nur im vertrauten Kreis und wartete ab. „Zu lange gewartet, zu lange gehofft …”, heißt es im Song der DDR-Band Pankow. Als mir das vollends klar wurde, existierte „meine DDR“ nur noch wenige Monate.
Gestrandet – Eine Jugendsünde
Es waren die letzten großen Schulferien vor dem Abitur. Ich war gerade 18 geworden, somit volljährig, und durfte zum ersten Mal ohne Erlaubnis meiner Eltern allein verreisen. Gemeinsam mit einem befreundeten Klassenkameraden plante ich eine Woche Zelturlaub an der Ostseeküste. Unsere Fahrräder wollten wir mitnehmen und uns auf dem Zeltplatz in Markgrafenheide bei Warnemünde ein Zelt mieten.
An einem Augusttag bestiegen wir in Brandenburg an der Havel mit unseren Rädern den Zug nach Rostock. Ab Rostock ging es mit den Fahrrädern weiter nach Warnemünde und Markgrafenheide, das noch etwa 10 Kilometer entfernt lag. Bei der Zeltplatzverwaltung wurde uns mitgeteilt, dass für diesen Tag alle Zelte vermietet waren, aber am nächsten Tag Zelte frei würden. Nun war guter Rat teuer, denn eine Übernachtung in einer Pension ließ unser Urlaubs-Taschengeld nicht zu. Wir fuhren nach Warnemünde zurück und suchten nach einer Übernachtungsmöglichkeit in einer Jugendherberge oder Ähnlichem. Wir fanden kein freies Zimmer und es wurde immer später. Jetzt suchten wir draußen nach einem geeigneten Platz zur Übernachtung. Den fanden wir auf der Warnemünder Seepromenade, die, durch Bäume und Sträucher abgeschirmt, gleich hinter dem Strand verlief. Auf den Bänken, die am Promenadenweg standen, ließ es sich unserer Meinung nach gut übernachten. Der Strand mit seinen bequemen Strandkörben kam leider dafür nicht in Frage. Dort durfte man sich nach 22 Uhr nicht mehr aufhalten, denn er befand sich im Grenzgebiet. Das wussten wir durch die Schilder, die in regelmäßigen Abständen aufgestellt waren. Bevor es dunkel wurde, fand jeder „seine Bank“, auf der er sich in seine Decke hüllte. Dass der Weg durch Laternen gut ausgeleuchtet war, störte mich nicht, denn ich war nach dem anstrengenden Tag sehr müde. Außerdem gab mir das Licht auch ein wenig ein Gefühl der Sicherheit. Welch ein Irrtum!
Ich war noch gar nicht richtig eingeschlafen, da hörte ich Geräusche. Eh ich mich versah, standen mir zwei Bewaffnete gegenüber, die mich und meinen Freund aufforderten, aufzustehen und mitzukommen. Es waren Matrosen der Grenztruppen (der sogenannten Grenzbrigade Küste), die uns auf ihre Wache brachten. Dort wurden unsere Personalien festgestellt und es erfolgte eine Befragung. Die Grenzer wollten zuerst wissen, warum wir uns im Grenzgebiet aufhielten, und dort ausgerechnet auf dem Postenweg. Wir beteuerten unser Unwissen, besser gesagt unsere Dummheit. Die nahmen sie uns ab, das heißt, sie glaubten uns. Nach einer Verwarnung entließen sie uns in die kühle Nacht. Dabei hätten wir gern in ihrem gemütlichen Klubraum noch einige Stunden geschlafen. Daran war nun nicht mehr zu denken. Auf dem Boden des geschlossenen Warteraums im Warnemünder Bahnhof sitzend, konnten wir kein Auge mehr zumachen. Im Morgengrauen machten wir uns wieder auf den Weg zum Zeltplatz. Dort gab es dann schließlich ein freies Zelt, in dem wir uns sofort schlafen legten. Wir reisten etwas früher als geplant wieder zurück nach Hause, denn das Taschengeld wurde knapp. Außerdem hatte der schlechte Urlaubsstart uns die Laune vermiest.
Aus heutiger Sicht hatte diese „Jugendsünde“ auch etwas Gutes für meine spätere berufliche Laufbahn. Vielleicht bewahrte sie mich vor einem Dienst bei den Grenztruppen. Ich war als angehender Berufssoldat für die Ausbildung an einer Unteroffiziersschule der Grenztruppen der Nationalen Volksarmee vorgesehen, doch Monate vor Beginn meines Wehrdienstes teilte mir mein Wehrkreiskommando mit, dass ich zur Unteroffiziersschule in Weißwasser/Haide komme.
Aufgemuckt
Im November 1969 begann meine Armeezeit. Am frühen Vormittag des 4. November 1969 befinde ich mich mit vielen anderen jungen Männern am Hauptbahnhof Brandenburg/Havel. Ein Personenzug steht bereit. Er wird mich und die anderen zu einer Kaserne der Nationalen Volksarmee in der Oberlausitz bringen. Am Nachmittag werden wir an einer Rampe am Rande eines Kiefernwaldes ankommen. Bis dahin ist alles ruhig und langsam verlaufen. Innerlich bin ich aber etwas aufgeregt und angespannt. Meine Anspannung wird noch etwas verstärkt durch die Art und Weise des Empfangs durch die künftigen Ausbilder und Vorgesetzten. Laute Kommandos ertönen, wir werden aufgerufen und zu Marschblöcken formiert. Dann geht es im Laufschritt zu den Unterkünften. Wir müssen eine Weile auf der Betonstraße laufen, an der sich mehrstöckige Unterkunftsblöcke aufreihen. Von den uns begleitenden Unteroffizieren werden wir immer wieder aufgefordert, das Tempo zu halten. Der Laufschritt wird in den nächsten Tagen und Wochen eine vorherrschende Bewegungsform sein. Nach Erreichen der Unterkunft passiert alles weitere im gefühlten 5-Minuten-Takt. Ein Pfiff auf dem Flur kündigt eine nächste Maßnahme an. Ihm folgt das Kommando „Fertigmachen zum Ausrüstungsempfang, Essen, Waschen,” usw. Ein kurz darauffolgender zweiter Pfiff bedeutet dann „Raustreten zur angekündigten Maßnahme”. Unter der empfangenen Bekleidung und Ausrüstung ist auch eine Zeltbahn, in die alles andere eingewickelt werden kann. Mit diesem Sack geht es zurück zur Mannschaftsunterkunft, einem Zimmer mit etwa 5 Doppelstockbetten und 10 Schränken. Jetzt müssen die Zivilsachen ausgezogen und in den mitgebrachten Taschen verstaut werden. Später werden sie eingesammelt und eingelagert. Unsere erste militärische Bekleidung bis zum Abend ist der Trainingsanzug. Der für uns zuständige Unteroffizier zeigt uns, wie wir den Schrank einräumen müssen und wie das Bett gebaut wird. „Schrank und Bettenbau“ heißt das nun in der Militärsprache. Ich betrachte meine neuen Uniformteile, bevor ich sie in den Schrank packe, und mir wird nun richtig bewusst, dass ich Soldat bin.
Aus irgendeinem Grund fehlt auf der Stube noch ein Bett und ich werde für eine Übernachtung in einer anderen Stube untergebracht. Es ist das Kraftfahrerzimmer, in dem Soldaten des 2. und 3. Diensthalbjahres untergebracht sind. Sie dienen nur 18 Monate und gelten schon als „alte Hasen“ oder „EK`s“, was „Entlassungskandidaten“ heißt. Kaum bin ich mit ihnen allein und will mich ins Bett legen, bekomme ich die Anweisung, ihre Kaffeebecher und Teller abzuwaschen. Einer von ihnen, ein Gefreiter, beruft sich auf seinen höheren Dienstgrad, der ihn berechtige, mir Befehle zu erteilen. Im Fall meiner Weigerung drohen sie mir „nächtliche Besuche“ an. Dann komme die „schwarze Kuh“ oder so ähnlich. Ich bin verärgert, aber auch verunsichert. Was habe ich denen getan, dass die mich so behandeln? Widerwillig nehme ich ihr Geschirr und gehe in den Waschraum. Da schon Nachtruhe ausgerufen wurde, falle ich dem Unteroffizier vom Dienst (UvD) auf. Bei dem beschwere ich mich über die Art und Weise, wie ich von meinen Zimmergenossen behandelt werde. Er folgt mir ins Zimmer und weist die drei zurecht. Nun sind sie wütend und kündigen mir eine unruhige Nacht an. Ich lege mich ins Bett und warte auf das, was geschehen soll. Weil lange nichts passiert, schlafe ich ein.
In den folgenden Tagen und Wochen gewöhnte ich mich nur sehr langsam an das neue Leben. Besonders an den Umstand, dass ich offensichtlich nicht in der Einheit gelandet war, für die ich mich mindestens 10 Jahre verpflichtet hatte. Das Wehrkreiskommando hatte mich für einen Einsatz bei einer Einheit des Kommandantendienstes (KD) vorgesehen. Die KD-Einheiten der NVA (Nationalen Volksarmee) waren für den Streifendienst und für die Verkehrsregulierung zuständig. Sie sind mit den heutigen Feldjägern der Bundeswehr vergleichbar. In meinen Augen war ich in diese Situation durch einen Vertragsbruch von Seiten der Armee gekommen und ich fühlte mich an meine Verpflichtung als Berufssoldat nicht mehr gebunden. Ein Berufsleben bei den Motorisierten Schützen, auch „Mucker“ genannt, konnte und wollte ich mir nicht vorstellen. Nach drei Wochen Grundausbildung kam die Gelegenheit, meine Sorgen vor dem Kommandeur loszuwerden. Vor der Vereidigung und der Ernennung zum Unteroffiziersschüler wurde mit jedem neuen Soldaten ein Personalgespräch geführt. Wohl zum ersten Mal im Leben akzeptierte ich einen „von oben“ (im Sinne von staatlicher Verwaltung) gefassten Beschluss nicht. Meine Bedingung war: entweder Berufssoldat beim Kommandantendienst oder nur drei Jahre in einer Motorisierten Schützeneinheit. Wenige Tage später durfte ich mich zwei Etagen höher im selben Block beim Chef der KD-Einheit als Neuer vorstellen.
„Je t`aime“ eingehakt
Die ersten Wochen seit Beginn meines Wehrdienstes in der NVA waren vergangen und die Grundausbildung war beendet. Ab Dezember 1969 erfolgte die Spezialausbildung für den Kommandantendienst. Dazu gehörte zum Beispiel der Unterricht in Kraftfahrzeugtechnik und militärischem Ordnungsdienst, sowie die praktische Ausbildung im Fahr- und Regulierungsdienst. Zum praktischen Teil des Ordnungsdienstes gehörte auch der Militärstreifendienst im Standortbereich, meist am Wochenende. Zum Standortbereich gehörten die Orte Kromlau, Gablenz, Krauschwitz und Bad Muskau. In diesen Orten gab es mindestens einen Gasthof, der von Armeeangehörigen im Ausgang aufgesucht wurde. Aufgabe einer Streife war es, Disziplin und Ordnung von Armeeangehörigen in der Öffentlichkeit zu kontrollieren und gegebenenfalls durchzusetzen. Kontrolliert wurde vor allem die Gültigkeit von Ausgangskarten, Dienstaufträgen und Urlaubsscheinen. Wert legte eine Streife auch auf die Einhaltung der Bekleidungsordnung durch die Armeeangehörigen.
An einem Sonnabend im Dezember 1969 stand also Streife im Dienstplan. Streifenführer Feldwebel Voigt ließ das Streifenfahrzeug, einen Robur LO, vorfahren, und außer mir nahmen noch zwei weitere Unteroffiziersschüler als Streifenposten auf der Ladefläche des LKW Platz. Es war schon fast dunkel, als wir einen Gasthof nahe Bad Muskau erreichten. Aus dem Lokal war Disko-Musik zu hören. Ein kurzer Blick durch die Eingangstür genügte, um zu sehen, dass der Innenraum übervoll war. Auf der Tanzfläche drängelten sich die Paare. Armeeangehörige waren fast in der Überzahl.
Wie üblich postierte der Streifenführer je einen Mann rechts und links vom Eingang. Er stellte sich in ihre Mitte und ließ seinen Blick über die Menge schweifen. Die Masse befand sich auf der Tanzfläche, im Halbdunkel wurde gerade „Je t‘aime“ gespielt. Die Paare schmiegten sich aneinander, es war kaum Platz zwischen ihnen. Unseren Feldwebel schien das nicht zu beeindrucken. Mit Adleraugen erspähte er inmitten der verschlungenen Paare einen Gefreiten mit nicht ganz geschlossenem Kragen der Uniformjacke. Der Haken an einem Kragenende war nicht (mehr) eingehakt, so wie es die Dienstvorschrift 10/5, die Bekleidungsvorschrift, vorschrieb. Ich, der neben dem Streifenführer stand, bekam den Befehl: „Unteroffiziersschüler Scheder, gehen Sie zu diesem Gefreiten und fordern Sie ihn auf, den Kragen zu schließen“. Mir blieb keine Zeit zum Überlegen. Mit einer Hand meine Pelzmütze und mit der anderen meine Pistolentasche haltend, drängelte ich mich durch die eng umschlungen Tanzenden. Ich spürte nicht nur ihre Blicke, sondern auch ihre Körper. Nachdem ich den Gefreiten erreicht hatte, sahen er und seine Partnerin mich an, als wäre ich aus einer anderen Welt. (Was ich ja in diesem Moment auch war.) Es bedurfte einer zweiten Aufforderung von mir, bevor er widerwillig den Kragen schloss. Nun konnte ich den Rückzug antreten, was für mich nicht weniger unangenehm war. Die ganze Sache war mir einfach peinlich, denn ich wäre am liebsten selbst unter den Tanzenden gewesen. Wahrscheinlich hätte ich den Kragen die ganze Zeit auch nicht so eng geschlossen gehalten. Diesen Ort verließ ich mit einem wehmütigen Gefühl, denn ich war 19, lange nicht mehr zuhause gewesen und fühlte mich in diesem Moment sehr einsam.
Der Steuermann
Meine erste Fahrt am Steuer eines Pkw absolvierte ich im Winter 1969/1970 auf der Fahrschulstrecke der Unteroffiziersschule der Landstreitkräfte in Weißkeisel. Als Unteroffiziersschüler und Angehöriger der Aufklärungs- und Kommandantendienst-Kompanie sollte ich zum Militärstreifenführer und Regulierer ausgebildet werden. Ich hatte wie die meisten meiner Kameraden nur den Motorrad-Führerschein. Unser Zugführer Oberleutnant Bochmann setzte trotzdem Fahrausbildung mit dem Kübelwagen Sachsenring P3 im Gelände an.
Im Fahrzeug nahmen der Zugführer und drei Fahrschüler Platz, und nach kurzer Unterweisung begann jeweils einer von den dreien mit einer Übungsrunde. Ich war als zweiter oder dritter an der Reihe. An meinem Fahrstil hatte der Zugführer wenig auszusetzen, nur mit meiner Lenktechnik in Kurven war er nicht einverstanden. Als ich in der nächsten Kurve wieder die Hände vom Lenkrad nahm und “übergriff”, korrigierte er mich, in dem er meine Hände am Steuer fixierte. Dadurch verlor ich kurzzeitig die Kontrolle über das Fahrzeug, das heißt, ich schaffte die Kurve nicht mehr. Ein Pfahl am Fahrbahnrand wurde umgefahren. Der Pfahl war aus Holz und so entstand kein Schaden am Fahrzeug.
Welche Fragen wirft diese Begebenheit auf?
Warum hatte ich mein Lenkverhalten nach der ersten Kurve nicht geändert?
War das „Eingreifen“ des Vorgesetzten ins Lenkrad gerechtfertigt?
Westbesuche
Ostdeutsche verstanden und verstehen bis heute unter „Westen“ nicht nur eine Himmelsrichtung, sondern auch „Westdeutschland“ und „Westberlin“. Für mich war schon als Vorschulkind „Westberlin“ ein Begriff, mit dem sich bestimmte Erlebnisse und Gerüche verbanden. Der „Westen“ roch für mich nach geröstetem oder frisch gebrühtem Bohnenkaffee, also sehr angenehm. Ich hatte nämlich eine Westberliner Urgroßmutter, die mal zu uns nach Plaue/Havel kam, oder die meine Eltern gelegentlich besuchten. Bis zum 13. August 1961 war die Einreise oder Durchreise durch Berlins Westen für DDR-Bürger noch möglich. Meine Eltern fuhren dann mit dem Personenzug nach Potsdam und stiegen dort in die Berliner S-Bahn. Am Grenzbahnhof Griebnitzsee gab es einen kurzen Aufenthalt und eine Kontrolle durch den DDR-Zoll. Danach ging es weiter, und schon waren sie in Westberlin. Als sie mich zum ersten Mal mitnahmen, war ich noch keine drei Jahre alt. Am S-Bahnhof Charlottenburg erwartete uns Hulda Sommer, so hieß meine Urgroßmutter, und brachte uns zu ihrer kleinen Wohnung in der Knobelsdorffstraße (Nr.13). Ihre Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung lag im obersten Stock eines Hinterhauses. Solche Bauten wurden auch „Mietskasernen“ genannt, mit Klo (Toilette) im Treppenhaus. Meine Eltern erzählten mir später von diesem ersten Besuch, denn ich probierte den Inhalt einer Dose NIVEA-Creme, den ich für Schlagsahne hielt.
Beim nächsten Aufenthalt in Berlin-Charlottenburg war ich vielleicht fünf oder sechs Jahre alt, denn daran kann ich mich noch gut erinnern. Meine Urgroßmutter hatte ein Zimmer an eine Frau mit Sohn untervermietet. Frau Hübners Sohn ging schon zur Schule. Ich bewunderte sein Plastikspielzeug und sein verchromtes Fahrrad. Am meisten imponierte mir sein amerikanisches Käppi, welches er von einem amerikanischen Soldaten geschenkt bekommen hatte. Ich musste es unbedingt aufsetzen und fand es schick, obwohl ich schon wusste, dass die „Amis“ keine Guten sein konnten.
1972, also mehr als ein Jahrzehnt später, kam es wieder zu einem Zusammentreffen mit der Urgroßmutter. Diesmal war es ungeplant und für mich überraschend, und das kam so: Als Offiziersschüler im zweiten Studienjahr, also ein Jahr vor meiner Ernennung zum Offizier, reichte ich einen Wochenendurlaub ein, der auch genehmigt wurde. Bei meiner Ankunft bemerkte ich zunächst einen „Westwagen“ vor dem Wohnhaus. Das war schon ungewöhnlich, aber ich konnte mir noch keinen Reim darauf machen. Erst als ich die Wohnung betrat, wurde mir alles klar. Im großen Wohnzimmer befanden sich außer meiner Schwester, meinen Eltern und Großeltern noch weitere Personen. Das waren die Urgroßmutter, eine verwandte junge Frau und ein Herr, der das Auto fuhr. Als Armeeangehöriger und angehender Offizier, also „Geheimnisträger“, waren mir „Westkontakte“ strikt verboten. Ich war in einer verzwickten Lage, aber wieder umzukehren, kam mir nicht in den Sinn, denn alle Anwesenden freuten sich über mein Erscheinen. Ab hier galt für mich: „Augen auf und durch“. Die Stimmung im Raum wurde noch besser, als Urgroßmutter ihre Schuhe auszog und aus ihnen mehrere 100-Mark-Scheine zog, also DDR-Mark, die sie an meine Eltern und Großeltern verteilte. Der Umtauschkurs von Westmark in Ostmark betrug zu der Zeit in den Westberliner Wechselstuben etwa 1:10, was meiner Urgroßmutter mit ihrer gewiss nicht hohen Rente zu einen vorteilhaften Geschäft verhalf. Schließlich kaufte sie ihre Lebensmittel so oft wie möglich in Ostberlin ein, wie sie selbst sagte. Unser Westbesuch musste noch am selben Tag abreisen, denn die Besuchserlaubnis galt nur bis 24 Uhr, dann musste der Grenzübergang passiert sein.
Sowohl die Westberliner als auch ihre „Ostverwandten“ hatten Besuche rechtzeitig in Berlin und Brandenburg anzumelden und zu beantragen. In Brandenburg war dafür das Volkspolizei-Kreisamt zuständig. Man kann auch davon ausgehen, dass der ABV (Abschnitts-Bevollmächtigter der Volkspolizei) in Plaue informiert war, aber so weit ging die Kontrolle doch nicht, dass er nachschauen ging, obwohl er gleich um die Ecke wohnte. Bis zur Rückkehr in meine Dienstelle hatte ich noch einen Tag Zeit, um mir zu überlegen, ob ich das Treffen vorschriftsmäßig melden wollte oder nicht. Ich tat es nicht und es passierte in der Folgezeit auch nichts!
Volle Drehung
Der „LO“, wie der robuste Robur-LKW aus Zittau in der DDR auch hieß, wurde auch in der NVA in verschiedenen Varianten eingesetzt. Als Pritschenfahrzeug, als Bus oder mit Spezialaufbauten. Dieses Fahrzeug lernte ich schon am Anfang meiner Armeezeit als Transportfahrzeug der Militärstreife kennen, zu der ich gehörte. Später befehligte ich als Batterieoffizier einen kleinen Wagenpark dieses Typs, denn die „Elos“ dienten als Transport- und Zugmittel für die Granatwerfer.
Einmal musste ich diesen LKW für den Zeitraum einer Übung selbst fahren. Das kam so: Mein neu zuversetzter Kfz-Gruppenführer hatte noch keine sogenannte Typenberechtigung für den LO und durfte deshalb nicht ans Steuer. So wurde mir die Aufgabe gestellt, das erste Fahrzeug meines Zuges selbst zu steuern. Eine Granatwerferbedienung (1 Unteroffizier und 5 Soldaten) und ein angehängter Granatwerfer mussten sicher durch sehr schwieriges Gelände transportiert werden, teilweise unter angelegter Schutzausrüstung. Außerdem musste die Technik auf einem Flachwagen der Eisenbahn aufgefahren und wieder abgeladen werden. Diese Aufgabe meisterten Fahrer und Fahrzeug ohne Probleme. Ich wusste nun, dass man sich auf dieses Fahrzeug verlassen konnte.
Dass ich mich auf meine Militärkraftfahrer verlassen konnte, hatte ich schon vorher erlebt. Meist waren sie im Zivilberuf Kfz-Schlosser, oder sie waren Berufskraftfahrer. Einmal, als ich mit meinem Kfz-Gruppenführer, einem älteren Gefreiten, auf einer wenig befahrenen Straße durch einen Truppenübungsplatz unterwegs war, fragte er mich, ob er mir ein Kunststück zeigen dürfe. Er behauptete, dass er den LKW einmal um seine Vorderachse, also um 360 Grad drehen lassen könne, denn es war Winter und die Asphaltstraße war glatt. Ich zögerte einen Augenblick und versuchte das Risiko zu kalkulieren. Der Gefreite war schließlich mein bester Fahrer. Außerdem wollte ich nicht kneifen und war auch neugierig. Nachdem er meine Zustimmung hatte, beschleunigte er kurz, schlug das Lenkrad etwas ein und zog die Handbremse. Der LO machte eine volle Drehung und kam wieder in Fahrtrichtung zum Stehen. Ich war erst einmal sprachlos, zunächst über sein Können, aber dann auch über meinen Leichtsinn.
Toccata und Fuge d-Moll
In der DDR fehlte immer etwas oder es war knapp. Vor allem fehlten Arbeitskräfte in Industrie und Landwirtschaft. Dieser Mangel wurde regelmäßig durch die Einberufung junger Männer zum Dienst in Armee und Bereitschaftspolizei, die sogenannten „bewaffneten Organe“, verstärkt. Die Wortschöpfung „bewaffnete Organe“ war, glaube ich, „made in DDR“ und ist bis heute in ihrer poetischen Schönheit unerreicht.
Die Nationale Volksarmee war also mit Arbeitskräften und Technik gut ausgestattet. Sie war sozusagen der größte Transportbetrieb der DDR. Während sie für die Rettung des Weltfriedens nur eine Nebenrolle spielte, so spielte sie für die Rettung der DDR-Volkswirtschaft oft eine Hauptrolle.
Im Herbst 1977, im Oktober, war es wieder mal so weit. Die Zuckerrübenernte musste eingebracht werden. Ich diente derzeit in einem Oranienburger Regiment und bekam den Auftrag, ein Erntekommando zu führen. Mir wurden über 30 Armeeangehörige mit geeigneter Berufsausbildung und zwei LKW-Typ „Ural“ unterstellt. Der Marschbefehl lautete: Kfz-Marsch von Oranienburg über Magdeburg nach Oschersleben. Die Kreisstadt Oschersleben ist Zentrum einer Landschaft, die man „Magdeburger Börde“ nennt und die an der DDR-Staatsgrenze zu Niedersachsen liegt. Vom dortigen Rat des Kreises Abteilung Landwirtschaft wurden wir schon erwartet. Nach Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden (der Abteilung Landwirtschaft) wurden meine Soldaten auf vier landwirtschaftliche Betriebe aufgeteilt. Die Vorsitzenden bzw. Leiter der Betriebe standen schon bereit, um sie zu übernehmen. Ich durfte ein Zimmer nahe dem Dienstzimmer und Sekretariat des 1.Vorsitzenden in einer Baracke beziehen. Auf seine Unterstützung und die seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war ich in den nächsten drei Wochen angewiesen, denn wie sollte ich denn sonst meine „Truppe führen“? Mit einem verbliebenen Kraftfahrer und einem Lastkraftwagen? Vom Grenzregiment in Oschersleben wurden mir zusätzlich noch 20 Soldaten und 10 LKW zugeteilt. Meine Gastgeber halfen mir aber, wo sie nur konnten. Meine Meldungen, Weisungen und Berichte wurden im Sekretariat abgetippt. Außerdem bekam ich ein Motorrad, um in den Einsatzorten wenigstens einmal täglich mit den Soldaten und den Bauern vor Ort Kontakt aufnehmen zu können. Es gelang mir sogar, eine Art sozialistischen Wettbewerb der FDJ-Gruppen (DDR-Jugendverband) zu führen. Von den mir unterstellten Soldaten kannte ich nur einige Personaldaten und wusste, dass sie alle in der FDJ waren. Ansonsten musste ich ihnen vertrauen und darauf hoffen, dass sie sich an den arbeitsfreien Sonntagen keinen Kurzurlaub genehmigten. In der Woche waren sie von früh bis abends beschäftigt und dann gab es für sie Freibier. Teilweise wohnten sie sogar über der Dorfgaststätte. Große Sorgen wegen Trinkgelagen wie ich sie vom Kasernenleben kannte, musste ich mir hier nicht machen.
An den Sonntagen aber nahm ich mir für die „Besuche“ in den Arbeitsorten mehr Zeit. An einem Sonntag, ich glaube, dass ich an diesem Wochenende meinen 2. Offizier in Kurzurlaub geschickt hatte, waren in einer der Unterkünfte nur fünf von sechs Soldaten anwesend. Von den übrigen bekam ich die Auskunft, dass der fehlende in der Kirche sei. Dagegen war nichts einzuwenden, doch wollte ich es genau wissen. Ich fuhr also zur Kirche, die nach meiner Erinnerung ziemlich groß war. Als ich sie betrat, schien sie mir leer zu sein, doch dann erklang die Orgel. Nachdem ich zu ihr hinaufgestiegen war, sah ich den Soldaten beim Orgelspiel. Er hatte die Jacke seiner Ausgangsuniform über einen Stuhl gehängt und saß da im langärmligen weißen Unterhemd. Was er da spielte, kannte ich nicht, aber er spielte sicher und es gefiel mir. Von den Schallplatten meiner Eltern kannte ich einige Orgelwerke von Johann Sebastian Bach und ich hörte sie auch gern. Ich fragte ihn zunächst, wo er das Orgelspielen gelernt habe. In seiner kirchlichen oder Pfarrersfamilie, antwortete er mir, so genau weiß ich das nicht mehr. Nun bat ich ihn, mir ein bestimmtes Bach-Orgelwerk vorzuspielen, Toccata und Fuge d-Moll. Bevor er damit begann, ging ich hinunter, setzte mich in eine der ersten Reihen der Kirchenbänke und genoss die folgenden Minuten.
Den Namen des Soldaten habe ich vergessen, sein Orgelspiel nicht. Ehrungen und Auszeichnungen nach dem Ernteeinsatz waren erwartbar, aber über dieses unerwartete Geschenk freute ich mich besonders.
Augen auf und durch
Dabel ist ein mecklenburgisches Dorf südöstlich von Schwerin. Neben dem Dorf stand eine Kaserne der Armee und eine Wohnsiedlung für die Berufssoldaten und ihre Familien. Im Sommer 1980 wurde ich nach Dabel versetzt und bezog eine kleine Wohnung, denn ich war noch unverheiratet. Um das zu ändern, suchte ich mit einer Annonce in der Kreiszeitung nach einer Partnerin.
In meinem Briefkasten waren nach einiger Zeit mehrere Briefe. Ich weiß nicht mehr, mit welchen jungen Frauen ich mich alles getroffen habe, aber eine Begegnung habe ich nicht vergessen. Eine Einladung zum Abendessen bekam ich aus der etwa 20-30 Kilometer entfernten Stadt Parchim. Von Dabel nach Parchim kam man nur mit dem Bus, der nur einmal in der Stunde fuhr, oder mit dem eigenen Fahrzeug gelangen. Ein Auto besaß ich nicht, aber einen Motorroller „Troll“. Es war inzwischen Winter geworden und ich trat an einem Wochentag nach dem Dienst die Fahrt nach Parchim in Winter-Dienstuniform an, also in Wintermantel, Stiefeln und Stiefelhose. Als Gepäck führte ich einen Beutel mit Schallplatten und natürlich Blumen mit mir. Den Beutel hängte ich an einen Haken unterhalb des Lenkers.
Bei Fahrtbeginn hatte es schon geschneit und die Straße wurde von einer dünnen Schneeschicht bedeckt. Ich musste also vorsichtig sein und durfte nicht zu schnell fahren. Nach einigen Kilometern Fahrt fing es noch stärker an zu schneien, sodass ich im Scheinwerferlicht kaum 5 Meter weit sehen konnte. Außerdem wurde es langsam dunkel. Am rechten Straßenrand tauchten plötzlich mehrere Wildschweine auf. Sie liefen eng beieinander und überquerten die Straße. Mein Abstand zu ihnen betrug nur noch wenige Meter und bremsen hätte bei dem Straßenzustand auch nicht mehr geholfen.
Dann ging alles sehr schnell. Vor dem Vorderrad meines Rollers tauchte ein Schweinekopf auf, dann gab es einen Ruck und ich fand mich auf der glatten Straße wieder. Ich war etwas benommen, aber unverletzt. Mein Roller lag einige Meter entfernt auf der Straße und noch etwas weiter lag ein Wildschwein. Vorsichtig näherte ich mich dem Tier, darauf gefasst, dass es wieder aufsprang und mich angriff, aber es bewegte sich nicht mehr. Nun ging ich zum Motorroller und begutachtete ihn. Er hatte keine Beulen und sichtbare Schrammen, sogar die Schallplatten im Beutel waren noch unversehrt, ebenso die Blumen. Nach mehreren Versuchen ließ sich der Roller wieder starten und ich konnte die Fahrt fortsetzen. Nach wenigen Minuten erreichte ich ein Betonwerk, das direkt an der Straße lag. Dem Pförtner berichtete ich vom Unfall und bat ihn, den Förster anzurufen.
In Parchim kam ich mit leichter Verspätung an und wurde schon von Mutter und Tochter in der Wohnung erwartet. Beim Ablegen meines Mantels berichtete ich von meiner unfreiwilligen Straßenbekanntschaft. Zu meiner Verwunderung löste mein Bericht bei beiden Frauen nicht nur Mitgefühl, sondern auch Heiterkeit aus. Sie sahen nämlich, dass am Gesäßteil meiner Stiefelhose ein markstückgroßes Loch war, durch das die nackte Haut schien, denn meine Unterhose hatte auch ein solches Loch. Mein Wintermantel hatte nur Schleifspuren an der Innenseite. Noch vor 22 Uhr trat ich die Rückfahrt nach Dabel an. Das Wildschwein lag nicht mehr auf der Straße und mein Besuch in Parchim blieb auch einmalig.
Überfahren
Ich kann mich bei der folgenden Episode nur an wenige Augenblicke und Details erinnern, das Meiste habe ich vergessen oder teilweise verdrängt. Es muss im Sommer 1981 auf einem Artillerie-Übungsgelände im Norden der DDR gewesen sein. Ich war während einer Regimentsübung eines Artillerie-Regiments als Kontrolloffizier bei einer Artilleriebatterie eingesetzt. In einem Zeitraum von mehr als 24 Stunden wurde die Feuerleitung geübt und schließlich wurde auch scharf geschossen. Die Kommandos wurden vom Regimentskommandeur an die Kommandeure der Abteilungen und Batterien mittels Funk übermittelt und dann kam es darauf an, dass die Geschütze in kürzester Zeit feuerbereit waren. Das wurde zunächst stundenlang geübt, wobei auch mehr oder weniger lange Pausen zwischen den Kommandos entstanden. Man konnte eigentlich nur warten bis etwas von „oben“ kam, aber dann musste alles sehr schnell gehen. Bei diesem Verfahren stellte sich auch recht bald eine gewisse Ermüdung ein, besonders als die Nacht einbrach. Ich wusste, dass bis zum Morgen kaum noch Handlungen zu erwarten waren, deshalb sah ich mich nach einem geeigneten Schlafplatz um. Nur wenige Meter hinter dem Stand des Batterieoffiziers (BO) fand ich eine Mulde im hohen Gras, in die ich mit meinem Schlafsack gut hineinpasste. Es war schon nach Mitternacht, als ich einschlief.
Durch das Brummen eines Motors wachte ich wieder auf. Es war schon hell, aber noch etwas dunstig. Das Motorgeräusch kam mal näher, mal schien es sich zu entfernen und mal verstummte es. Aha, dachte ich, das ist der LKW, der die Granaten zu den Geschützen transportiert. In meiner Schlafmulde in etwa 20 Metern Entfernung von den Geschützstellungen und wenige Meter hinter dem BO-Stand wähnte ich mich in Sicherheit. Ich konnte mir noch etwas Zeit zum Aufstehen lassen. Das war ein Irrglaube, denn das Motorbrummen kam immer näher und eh ich mich versah, tauchte über meinem Kopf ein großes LKW-Rad auf. Instinktiv drehte ich mich auf die rechte Seite und zog den Kopf ein. Der große Durchmesser des Rades und seine Breite bewirkten, dass meine Mulde mehr überfahren als durchfahren wurde und ich kaum etwas spürte. Auch als die hinteren Reifen der Doppelachse über meinen linken Oberschenkel rollten. Die schmaleren Reifen des Anhängers hinterließen bei mir einen deutlich schmerzhafteren Eindruck. Ich sprang aus meiner Mulde, raffte meinen Schlafsack zusammen und bewegte mich humpelnd in Richtung der Geschütze. Mein linker Oberschenkel leuchtete noch Wochen danach in fast allen Farben und einige Tage hatte er Muskelkater. Weder der LKW-Fahrer noch irgendjemand anderes hatten von allem etwas mitbekommen. Darüber war ich froh, denn dieses Vorkommnis hätte für mich disziplinarische Konsequenzen gehabt. Außerdem war mir das Ganze peinlich, deshalb behielt ich das Erlebte lange Zeit für mich.
Mutter und Vietnam

Lehrerin Marianne Scheder (*28.10.1923) aus Brandenburg an der Havel mit jungen Vietnamesen und deutschem Betreuer. 1980er Jahre ?
Es ist wahrscheinlich, dass dieses Foto noch kurz vor oder nach ihrem Renteneintritt 1983 entstand. Bis zur Rente arbeitete sie in der Sonderschule der Orthopädischen Klinik Kirchmöser. In Kirchmöser könnte diese Aufnahme auch entstanden sein. Dort befanden sich das Werk für Gleisbaumechanik und das Reichsbahn-Ausbesserungs-Werk (RAW).
Eine Frage an den Genossen Wolf
Im November oder Anfang Dezember 1989 hieß es für die Kommandeure und ihre Stellvertreter der in der Beelitzer Kaserne vorhandenen Einheiten: „Antreten am Kasernentor!“ Anlass war die Verleihung des Namens „Friedrich-Wolf-Kaserne“. Den Namen des Kommunisten und Schriftstellers Friedrich Wolf hatte das Panzerregiment-1 getragen, für das die Kaserne ursprünglich gebaut worden war. Im Zuge der Reduzierung von Personal und Technik der NVA, im Januar 1989 von Erich Honecker verkündet, wurde das Panzerregiment Beelitz aufgelöst und sein Personal in eine Ausbildungsbasis überführt. Die Angehörigen dieser ABAS genannten Einheit wurden dann die meiste Zeit in der Volkswirtschaft eingesetzt.
Auf der Straße vor dem Kaserneneingang stand nun eine Gruppe von etwa 15 bis 20 Offizieren und wartete auf den angekündigten Besuch von Markus Wolf, durch den die Namensgebung erfolgen sollte. Der kam nicht in seiner Uniform, sondern in Zivilkleidung. Ich stand in der angetretenen Reihe nur etwa drei Meter von ihm entfernt und konnte ihn gut hören und beobachten. Nach meiner Erinnerung trug er einen langen, grauen bis beigefarbigen Mantel und redete ohne Manuskript. In seiner kurzen Rede erwähnte er die Briefe, die ihm sein Vater geschrieben hatte, in denen es um die „Zivilcourage“ ging. Er sprach davon, wie wichtig diese Zivilcourage gerade jetzt in dieser Phase der gesellschaftlichen Entwicklung in der DDR sei. So habe ich ihn jedenfalls verstanden und ich formulierte in Gedanken eine Frage an ihn, die lautete: „Welche Rolle spielte die Zivilcourage in deinem Leben?“ Da ich nicht die Möglichkeit hatte, anschließend direkt auf ihn zuzugehen, blieb es nur eine fiktive Frage. Ich erinnere mich nicht mehr an die Namenstafel, welche dann enthüllt wurde, und in den folgenden Wochen und Monaten habe ich sie auch nicht weiter beachtet. Ich vermute, dass sie spätestens im März 1990 wieder abgenommen wurde.
Das Jahr 1989 – ein persönlicher Bericht
Gefühle die mich im Verlauf des Jahres 1989 bewegten:
Bis Oktober zunächst der Glaube an die Reformierbarkeit von Partei und Staat.
Hoffnung auf einen Personal- und Politikwechsel (Glasnost) an der Parteispitze.
Enttäuschung über ausbleibende Reaktionen der Parteiführung auf Massenflucht und Demonstrationen.
Zweifel an der Handlungs- und Reformfähigkeit der Parteiführung unter E.H. (Erich Honecker).
Ärger über Machtmissbrauch und ungerechtfertigte Privilegien einiger Parteifunktionäre.
Bereitschaft zur aktiven Teilnahme an der Umgestaltung (Perestroika) der DDR.
Verunsicherung über die weitere politische Entwicklung der DDR (besonders ab dem 9.11.)
Persönliche Zukunftsängste
Wie ich den 4. November 1989 erlebte
Der Appell, auf welchem der Abteilung der Einsatz als Hundertschaft zur Absicherung des friedlichen Verlaufs der Großdemonstration am 4. November auf dem Berliner Alexanderplatz bekanntgegeben wurde, fand nach meiner Erinnerung kurz vor dem Einsatz statt. Vielleicht war es sogar der 3. November (ein Freitag). Einsatzgrundlage war der Befehl des Ministers für Nationale Verteidigung Nr. 105/89 vom 27. September 1989. Zur Unterstützung der Sicherheitsorgane, also von VP (Volkspolizei) und MfS (Ministerium für Staatssicherheit), entschloss sich die Armeeführung Anfang Oktober 1989, nichtstrukturmäßige Hundertschaften der Armee zu bilden, die allerdings in der zweiten Reihe stehen sollten. Insgesamt hielt die SED-Führung (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) in der Zeit vom 4. Oktober bis zum 11. November 1989 zeitweise bis zu 183 NVA-Hundertschaften mit einer Personalstärke von rund 20.000 Mann einsatzbereit.
Mein Kommandeur Oberstleutnant Junghans verlas den Einsatzbefehl. Er sprach auch von einer Sicherheitspartnerschaft zwischen den Demonstranten, der VP und den Hundertschaften der NVA. Das fand ich zu mindestens beruhigend, schließlich hatten wir Angehörige der Abteilung bis dato keine Erfahrungen mit Demonstrationen bzw. Demonstranten. Trotzdem blieb noch ein Gefühl der Unsicherheit. Die Anzugsordnung war für alle Dienstuniform. Es wurden keine Waffen mitgeführt, nur die Offiziere erhielten ihre Pistole mit 2 Magazinen (je 6 Patronen). Auf dem LKW des Hauptfeldwebels befanden sich aber in versiegelten Kisten Teleskopschlagstöcke für die Selbstverteidigung (wie es hieß). Der Kolonnenmarsch begann im Objekt Beelitz am frühen Morgen und führte uns über Teltow, Schönefeld, Berlin Adlershof zum Werderschen Markt im Berliner Zentrum. Aus dem UAZ (Uljanowski Awtomobilny Sawod, kurz UAZ) des Kommandeurs sah ich kurz vor unserer Ankunft schon die ersten Demonstranten gegenüber der Stadtbibliothek an der Ecke des Staatsratsgebäudes. Unter ihnen waren Ordner mit gelben Schärpen, auf denen deutlich „keine Gewalt” zu lesen war. An einem Funkstreifenwagen der VP, der vor dem Staatsratsgebäude stand, hielten sich Volkspolizisten auf, die die gleichen gelben Schärpen trugen. Unmittelbar neben der Friedrichwerderschen Kirche bezogen wir mit unseren Fahrzeugen, mehreren Tatra-LKW vom Typ 815 und dem UAZ des Kommandeurs, unseren Bereitstellungsraum. Diesen Platz gegenüber dem Außenministerium teilten wir uns mit einer Hundertschaft Bereitschaftspolizei, zu der auch eine Hundestaffel gehörte. Um den Verlauf der Großdemonstration verfolgen zu können, kamen zwei Kofferfernseher zum Einsatz. Die Geräte wurden so auf unsere Fahrzeuge gestellt, dass möglichst viele Armeeangehörige etwas hören und auch sehen konnten, denn dieses Ereignis wurde vom Fernsehen der DDR direkt übertragen.
Als die ersten Bilder vom Alexanderplatz gesendet wurden, war ich von den Menschenmassen sehr beeindruckt. Dieser Eindruck verstärkte sich noch, als ich in Richtung Staatsrat blickte und den Platz davor (Marx-Engels-Platz) mit Demonstranten gefüllt sah. Falls Demonstranten in Richtung Brandenburger Tor (also in unsere Richtung) marschieren wollten, sollten unsere Soldaten die Schleusenbrücke besetzen, um ihnen den Weg zu versperren. Diese Situation trat in dem Moment ein, in dem wir gerade beim Essensempfang an der mitgeführten Feldküche waren. Zunächst aber besetzten die jungen Bereitschaftspolizisten die Brücke, dann bildeten unsere Soldaten eine zweite Reihe hinter ihnen. Das ganze Manöver dauerte nur wenige Minuten, denn es stellte sich schnell heraus, dass die Zahl der Demonstranten auf dem Marx-Engels-Platz derartig gewachsen war, dass sie in Richtung Schleusenbrücke ausweichen mussten. Die Aktivitäten der Polizisten und NVA-Soldaten wurden von Demonstranten mit Pfiffen quittiert. Bis zum Ende der Demonstration gab es keine weiteren Vorkommnisse.
Zwei Begebenheiten sind mir noch in besonderer Erinnerung geblieben.
Noch vor dem offiziellen Demonstrationsbeginn bekam ich von meinem Kommandeur den Auftrag, einen Umschlag (vermutlich Stärkemeldung) im Stab der Volkspolizei abzugeben. Der provisorische Stab befand sich im alten Palais am Bebelplatz. Auf dem Weg dorthin passierte ich mehrere bewaffnete Kontrollposten des MfS-Wachregiments und der VP. Ich hatte den Eindruck, dass der Weg zum Brandenburger Tor gut gesichert war.
Die zweite Begebenheit, die mich nachdenklich machte, ereignete sich, nachdem wir den Bereitstellungsplatz bezogen hatten und uns dort „einrichteten”. Aus Richtung des uns gegenüberliegenden ZK-Gebäudes näherte sich uns ein junger Offizier im Rang eines Unterleutnants. Er meldete sich mit Dienstgrad und Namen bei meinem Kommandeur und stellte sich vor als „Zugführer (oder Wachhabender) des MfS-Wachzugs beim ZK (Zentralkomitee) der SED”. Nach meiner Erinnerung bat er meinen Kommandeur um eventuelle Weisungen bzw. Informationen. Oberstleutnant Junghans schätzte die Lage ihm gegenüber als entspannt bzw. beherrschbar ein. Scheinbar beruhigt trat der junge Zugführer den Rückweg zum ZK-Gebäude an. In diesem Moment und auch später stellte ich mir die Frage, ob er der einzige Offizier im ZK-Gebäude war.
5 DM für einen Stadtplan
Die Grenze zwischen Ost- und Westberlin und zwischen Ost- und Westdeutschland existierte am Jahresende 1989 noch, aber sie war durchlässig geworden. Bürger der DDR durften sie nun jederzeit passieren. Einige meiner Mitgenossen in Beelitz waren schon in Westberlin gewesen. Nun wollte auch ich wissen, wie es auf dem Kurfürstendamm aussieht. Ein geschäftstüchtiger Beelitzer Taxiunternehmer bot bereits Ende November 1989 Fahrten nach Westberlin an, die man in Ostmark bezahlen konnte, denn Westgeld für über 100 km Strecke Hin- und Rückfahrt hatten zu der Zeit die wenigsten Beelitzer. Ich besaß gerade einmal 5 D-Mark, die ich mir irgendwo eingetauscht hatte.
Mit dem Taxifahrer vereinbarte ich eine Fahrt zum Westberliner Zentrum. Straßenbezeichnungen kannte ich nicht, denn auf DDR-Karten war da, wo Westberlin sein sollte, nur graue Fläche. Nach Dienstschluss zog ich meine Zivilsachen an und bestieg wenig später das Taxi. Die Fahrt dauerte vielleicht weniger als eine Stunde, dann hielt der Wagen in Sichtweite einer Kirche. Nach Auskunft des Fahrers befanden wir uns am Breitscheidplatz. Das sagte mir erst einmal nichts und ich orientierte mich an der Kirche, um nur eine kleine Runde zu laufen. In etwa 50 Metern Entfernung sah ich einen Zeitungskiosk, der Platz wurde durch eine Vielzahl von Leuchtreklamen erhellt. Auf dem Weg zum Kiosk passierte ich mehrere Schaufenster. Vor einem mit der Überschrift „Yesterday“ saß ein junger Mann auf dem Bürgersteig. Vor ihm stand ein Pappschild, auf dem stand: „Ich habe Hunger“. Ich lief unbeirrt weiter, aber ich fand in diesem Moment alle meine Vorurteile über den „Westen“ bestätigt. Am Kiosk kaufte ich dann für genau 5 DM einen „richtigen“ Stadtplan von Berlin. Mit schnellen Schritten ging es wieder zum Taxi zurück. Ich war erleichtert, als ich wieder im Taxi saß und es wieder in Richtung Heimat fuhr. Das war noch nicht „meine Welt“. Bis sie es werden konnte, musste noch einige Zeit vergehen.
Wie das Jahr 1989 für mich endete und wie das Jahr 1990 für mich begann
Die Stimmung in meiner Parteiorganisation im November und Dezember 1989 war vor allem von den Oktober-Ereignissen in Berlin und vom Einsatz unserer Abteilung bei der Großdemonstration auf dem Berliner Alexanderplatz am 4. November 1989 geprägt. Wir gehörten zu den 14 Hundertschaften der 1. MSD (motorisierte Schützendivision), welche in der Hauptstadt zum Einsatz kamen. Soweit ich mich erinnere, sollten wir in Zusammenwirken mit der Volkspolizei den friedlichen Verlauf der Demonstration gewährleisten. Auf der letzten Parteiversammlung am 29. November 1989 beschlossen wir die Auflösung der Go 881 (Grundorganisation 881) im TT (Truppenteil) und die Gründung einer Parteiorganisation im Wohngebiet. Die letzte Sitzung der Parteileitung fand dann am 27. Dezember 1989 statt.
Als hauptamtlicher Parteisekretär hatte ich nun keine Perspektive mehr, hing in der Luft. Mein Kommandeur OSL (Oberstleutnant) Bernd Junghans wusste Rat. Ab Januar 1990 wurde ich auf eine gerade freie operative Planstelle im Stab der Abteilung gesetzt. Im Verlauf des Monats Februar erfolgte meine Kommandierung zum Verband der Berufssoldaten (VBS) in Potsdam. Mein Kalender dokumentiert den ersten Kontakt mit dem Leiter der gerade erst geschaffenen Kreisgeschäftsstelle Potsdam des VBS der DDR, OSL Joachim Pribbenow am 17. Februar 1990. Wie ich war auch er als ehemaliger Angehöriger eines Politorgans der NVA hierher kommandiert worden. Nach meinem Urlaub Ende Juli führte ich praktisch allein die Geschäfte, da Joachim seinen Resturlaub nahm und sich auch noch auf seine Entlassung vorbereiten wollte.
Meuterei? Beelitz „Friedrich-Wolf-Kaserne“ 2. Januar 1990
Nach dem Silvesterwochenende traf ich wieder in Beelitz ein und begab mich zur Kaserne. Sie lag an der Straße nach Beelitz-Heilstätten und war von meiner Wohnung in ca. 15 Minuten zu Fuß zu erreichen. Noch vor der Einfahrt zur Dienststelle fielen mir einige teilweise noch brennende Kerzen auf, die am rechten und linken Straßenrand standen. Auf dem Parkplatz vor dem Kasernentor hielten sich viele Armeeangehörige auf. Sie trugen ihre Felddienstuniformen (Watteuniformen) und standen meist an kleinen Wärmefeuern. Als ich mich bei meinem Kommandeur im Unterkunftsblock meldete, meinte er nur: „Zieh die Felddienst an und mische dich unter die Soldaten vor der Kaserne“. Dort traf ich auch einige Offiziere und Unteroffiziere aus meiner Abteilung, die mich über die Lage informierten. Ich erfuhr, dass alle Vorgesetzten des Regiments, der Division und der Landstreitkräfte, die bisher vor Ort waren, bei den streikenden Soldaten und Unteroffizieren kein Gehör gefunden hatten. Sie wurden von ihnen einfach ignoriert. Davon konnte ich mich beim Auftritt von Generalleutnant Skerra vor ihnen selbst überzeugen. Das hatte ich in meiner fast 20-jährigen Dienstzeit noch nicht erlebt. Trotzdem war ich davon nicht wirklich überrascht. Die Stimmung unter den Angehörigen meiner Abteilung war schon seit Wochen nicht gut. Die Berufssoldaten hatten Sorgen um ihre berufliche Zukunft und die Soldaten sahen nicht ein, dass sie nicht mehr Ausgang und Urlaub bekamen. Stattdessen wurde ein Teil von ihnen wochenlang in der Volkswirtschaft eingesetzt. Nach einigen „Ausschreitungen“ in der Silvesternacht hatten sich „Soldatenräte“ gebildet, die dann auch durch ihre Vorgesetzten und Kommandeure unterstützt wurden. Die sorgten zum Beispiel dafür, dass ihre schon schriftlich formulierten Forderungen abgetippt und vervielfältigt wurden.
Eine zentrale Forderung war, dass der Minister für Nationale Verteidigung persönlich erscheinen sollte. Nach langem Warten kam er dann auch. Ein großer Wagen hielt noch auf der Straße vor dem Kasernentor. Ein Marineoffizier öffnete Admiral Theodor Hoffmann die Wagentür. Der Minister ging, ohne zu zögern auf die Menge vor dem Tor zu. Ich erinnere mich, dass sich sofort ein Spalier für ihn bildete und ihm auch vereinzelt Beifall gespendet wurde. Dann ging er weiter in den Regimentsklub, wo er schon von einer Delegation aus Soldaten, Unteroffizieren und Offizieren erwartet wurde. Nach einiger Zeit kam er wieder aus dem Klubgebäude, bestieg einen Anhänger, der als eine Art Tribüne neben dem Tor stand, und wandte sich an die Wartenden. Nachdem er zum Ausdruck gebracht hatte, dass er die aufgestellten Forderungen für berechtigt halte und sie umgesetzt werden, gab es erkennbare Zustimmung. Der Beifall für ihn war diesmal deutlich stärker. Seine abschließenden Worte haben sich mir besonders tief eingeprägt. Er sagte: „Und nun bitte ich Sie, meine Herren, gehen Sie in die Kaserne und nehmen den Dienst wieder auf“. Unmittelbar danach bewegten sich alle Anwesenden wieder zu ihren Unterkünften in der Dienststelle.
Wanzen können nützlich sein
Kennt jemand von euch den Liedreim-Anfang „Auf der Mauer auf der Lauer sitzt ne kleine Wanze …“ ? Wenn nicht, dann ist die folgende Begebenheit trotzdem gut zu verstehen. Meine Tochter zog 2014 von Neustadt an der Weinstraße (Rheinland-Pfalz) nach Havelberg (Sachsen-Anhalt). Natürlich half ich ihr bei der Reinigung der neuen Wohnung, die in einem DDR-Plattenbau-Viertel lag. Die Wohnung muss nach 1990 modernisiert worden sein, was am Bad, am Bodenbelag und an den Fenstern gut zu erkennen war. Ich nahm mir die Reinigung der Heizkörper in allen Räumen vor, denn sie waren innen und an ihrer Hinterseite stark verschmutzt und verstaubt. In der Küche und im Wohnzimmer fielen mir beim Wischen hinter der Heizung jeweils zwei kreisrunde magnetische Plättchen mit 9 mm Durchmesser auf. Dem schenkte ich jedoch keine weitere Beachtung, bis ich hinter der Heizung eines weiteren Raumes einen zylinderförmigen magnetischen Gegenstand von 10 mm Durchmesser fand. Spätere Recherchen bestätigten meine Vermutung, dass es sich hierbei um eine elektronische Wanze handelte.
In dem besagten Havelberger Wohnviertel lebten schon seit DDR-Zeiten vor allen Angehörige der Kreisverwaltung sowie der Polizei und der Nationalen Volksarmee. Ich wohnte dort mit Frau und Kindern von 1982 bis 1985. Ab Oktober 1990 übernahm die Bundeswehr die nahe gelegene NVA-Kaserne und damit auch einen Teil des bisherigen Personals. Fazit: Wanzen können für Geheimdienste nützlich sein, aber auch für den persönlichen Erkenntnisgewinn.
Persönliche Erinnerungen an DDR-Leben und Geschichten mit DDR-Bezug
Unsere Erinnerungs-Bibliothek darf weiterwachsen. Habt Ihr ebenfalls Erinnerungen an das Leben in der DDR oder Geschichten mit DDR-Bezug, die Ihr hier veröffentlichen möchtet? Gerne könnt Ihr uns diese per E-Mail (info@kulturaktiv.org) oder per Post (Kultur Aktiv e.V., Bautzner Straße 49, 01099 Dresden) zuschicken.
Das Projekt Treffpunkt ostZONE. Erinnern und gestalten wird gefördert durch das House of Resources Dresden +. Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes im Rahmen des Landesprogrammes Integrative Maßnahmen.